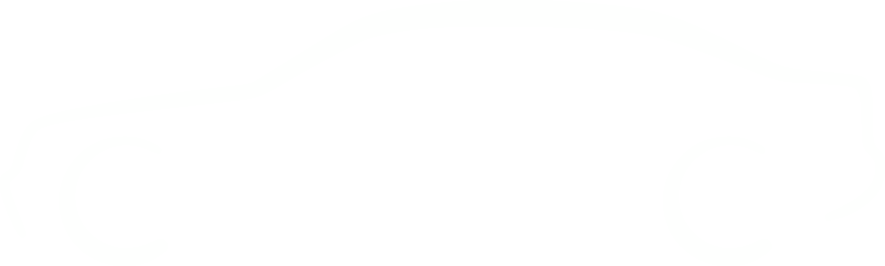Moin,
ein Hinweis aus aktuellem Anlass:
Bei einem CDI mit unklarem Raildruck sollte kein Startpilot eingesetzt werden.
Wenn ein CDI nicht anspringt kann das mehrere Gründe haben.
Wenn er (wie alle Selbstzünder) mit Startpilot läuft hilft das für die Fehlersuche wenig, dieser Versuch kann aber Nachteile bringen.
Neben fehlendem Kraftstoff kann auch ein fehlendes / unplausibles Signal vom Kurbelwellensensor den Start verhindern,
Wenn das MSG das Signal des Kurbelwellensensors nicht erhält wird trotz drehendem Motor die Startsteuerung CDI im MSG nicht aktiv.
Das Druckregelventil wird nicht angesteuert, in der Folge wird kein ausreichender Raildruck aufgebaut. (vergl, Dokument AD07.16-P-5000A, Starter dreht, Raildruck ca. 60 bar)
Auch bei fehlendem Kraftstoff oder zuviel Luft im System ist der Raildruck möglicherweise sehr gering. (Mindestdruck für Freigabe Einspritzung durch MSG ist 800 bar, Regeldruck bei Startdrehzahl nach 40 sec >1100 bar)
Um zu verstehen, warum bei geringem Raildruck keine Zündung durch Startpilot stattfinden sollte muss man die Funktionsweise des Injektors im OM 611 berücksichtigen.
Hier ein allgemeines Schaubild (das im unteren Teil dargestellte Außengewinde gibt es beim tatsächlichen Injektor des OM 611 nicht):

Die wesentlichen Bauteile sind eine lange, abgestufte Düsennadel als beweglicher Verschluss, eine Feder an der Nadel und ein elektrisch betätigtes Ventil im Kopf, das ebenfall von einer Feder (ganz oben) geschlossen wird.
Der Injektor wird von der Feder an der Düsennadel geschlossen gehalten, damit der (relativ geringe) Verdichtungsdruck beim Durchdrehen des Motors keinen Schmutz in den Injektor bringen kann und sich das Sytem nicht in Standzeiten zum Brennraum hin leeren kann.
Der geringe Federdruck führt zu Problemen beim Einsatz von Startpilot. Wenn die Verdichtung von fremd eingespritztem Stoff eine Zündung ergibt ist eventuell (noch) kein Raildruck vorhanden und der Explosionsdruck kann die Nadel möglicherweise aufdrücken.
Der Hochdruckbereich ist im unteren Teil der Darstellung blau eingefärbt.
Der Kraftstoffdruck liegt bei geschlossenem Magnetventil (Ruhezustand) sowohl unten an einer Ringfläche der Nadel (Druckkolben mit kleiner Fläche, drückt nach oben) als auch oben über dem vollflächigen Ende der Nadel (Kolben mit großer Fläche, drückt nach unten).
Erst der steigende Kraftstoffdruck in der Rail drückt über den großen Kolben die Verschlussnadel mit großer Kraft nach unten (zu), der deutlich kleinere (Ring-) Kolben drückt gleichzeitig mit gleichem Kraftstoffdruck, aber weniger Fläche = kleinerer Kraft nach oben (Injektor geht noch nicht auf).
Erst bei 800 bar beginnt das MSG mit Einspritzung,
Zum Öffnen wird die Kammer über dem großen Kolben über ein elektrisches Ventil in den Rücklauf entleert, der kleine Kolben drückt die Nadel sofort auf, der Kraftstoff wird eingespritzt.
Die große Kammer ist über eine kalibrierte Bohrung mit der Rail verbunden, es fließt während der Öffnungszeit Kraftstoff nach.
Weil die Ablaufbohrung am Ventil zum Rücklauf größer ist als der kalibrierte Zulauf vom Hochdruckbereich baut sich aber erst wieder Druck auf, wenn das Ventil schließt. Dann hat der größere Kolben wieder mehr Kraft und drückt die Nadel nach unten zu.
Die hohe Kraftüberschuss des größeren Kolbens hält die Nadel auch bei der Explosion des eingespritzten Kraftstoffs zum Brennraum hin dicht.
Zwischen beiden Kolben ist an der Nadel ein Bereich, der permanent zum Rücklauf offen ist, dadurch ist der Raum um die Feder praktisch drucklos. Erst dadurch können die Kolben ihre Wirkung entwickeln und hier fließt tatsächlich permanent Lecköl, das zwischen beiden Kolben und den Bohrungswänden hindurch drückt in den Rücklauf.
Die tatsächliche Rücklaufmenge ist die Suumme aus dem für die hydraulischen Bewegungen der Nadel benötigten Kraftstoff und den verschleißbedingten Verlusten.
Deshalb ist die maximale Rücklaufmenge dieser Injektoren auch von der Anzahl der Öffnungen abhängig (Vorgabe: Bei Drehzahl 4.5001/min maximal 150 ml je Minute pro Injektor)
Meine Befürchtung:
Wenn die Rail nicht unter Hochdruck steht ist die Feder an der Verschlussnadel des Injektors allein nicht für die Abdichtung gegen den hohen Verbrennungsdruck eines extern eingespritzten Kraftstoffs geeignet.
Gruß
Pendlerrad